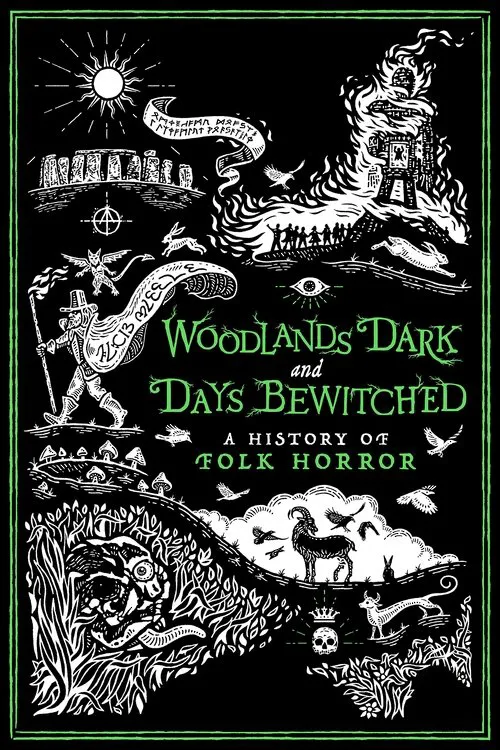Woodlands Dark and Days Bewitched: Eine Geschichte des Folk-Horrors
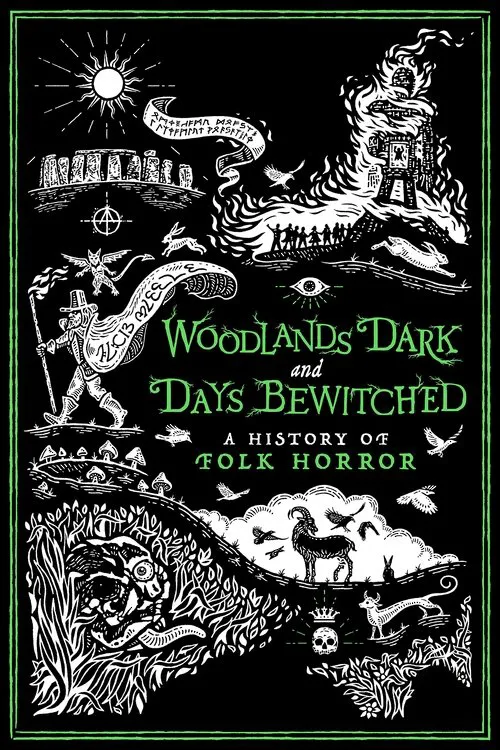
Handlung
Woodlands Dark and Days Bewitched: Eine Geschichte des Folk-Horrors ist eine filmische Erkundung, die tief in die reiche und komplexe Geschichte des Folk-Horrors eintaucht, einem Genre, das das Publikum mit seiner unheimlichen und oft beunruhigenden Darstellung ländlicher Umgebungen und der dunklen, übernatürlichen Kräfte, die darin lauern, in seinen Bann zieht. Von seinen bescheidenen Anfängen in Großbritannien in den späten 1960er Jahren über seine Verbreitung im britischen Fernsehen in den 1970er Jahren bis hin zu seinen zahlreichen Ausprägungen in verschiedenen Ländern hat sich dieses Genre im Laufe der Jahre weiterentwickelt und die kulturellen Ängste und Befürchtungen seiner Zeit widergespiegelt. Der Film beginnt mit der Veröffentlichung von Piers Haggards Film „The Devil's Backbone“ aus dem Jahr 1971, einem frühen Beispiel für Folk-Horror, das den Ton für das Genre angab. Robin Hardys Film „The Wicker Man“ aus dem Jahr 1973 festigte jedoch erst wirklich den Platz des Genres in der Filmgeschichte. Dieser ikonische Film, in dem Edward Woodward einen Polizisten spielt, der auf eine abgelegene schottische Insel reist, um das Verschwinden eines jungen Mädchens zu untersuchen, ist eine Meisterleistung in Sachen Spannung und Vorahnung, da er langsam eine Geschichte alter heidnischer Praktiken und Menschenopfer enthüllt. Der Einfluss von „The Wicker Man“ ist bis heute spürbar, und seine kulturelle Bedeutung ist ein Beweis für die anhaltende Kraft des Folk-Horror-Genres. Die 1970er Jahre sahen auch eine Zunahme von Folk-Horror im britischen Fernsehen, mit zahlreichen Filmen und Serien, die die dunkle Seite des ländlichen Lebens erkundeten. Der Film beleuchtet die Arbeit von Regisseuren wie Lindsay Shonteff und Don Sharp, die eine Reihe von Folk-Horror-Filmen produzierten, darunter „The House of Seven Corpses“ bzw. „The Hunchback of the Morgue“. Diese Filme haben vielleicht nicht die gleiche kulturelle Wirkung erzielt wie „The Wicker Man“, aber sie trugen dazu bei, das Genre als festen Bestandteil des britischen Kinos zu etablieren. Folk-Horror ist jedoch nicht auf Großbritannien beschränkt, und der Film untersucht die Ausprägungen des Genres in verschiedenen Ländern. Die Dokumentation hebt die japanischen Folk-Horror-Filme der 1960er und 1970er Jahre hervor, darunter „Kwaidan“ und „Blind Beast“, die ein ähnliches Gefühl von Unbehagen und Vorahnung vermitteln, das für das Genre charakteristisch ist. Diese Filme, die oft folkloristische und mythologische Themen verwenden, bieten eine einzigartige Perspektive auf die menschliche Verfassung und unseren Platz in der natürlichen Welt. Das Wiederaufleben des Folk-Horrors im letzten Jahrzehnt hat eine neue Welle von Filmemachern hervorgebracht, die sich von der reichen Geschichte des Genres inspirieren lassen. Der Film hebt die Arbeit von Regisseuren wie Ari Aster und Robert Eggers hervor, die mit „Hereditary“ bzw. „The Witch“ Kritikererfolge erzielt haben. Diese Filme sind zwar nicht im strengen Sinne Folk-Horror, vermitteln aber ein ähnliches Gefühl von Unbehagen und Vorahnung, das für das Genre charakteristisch ist. Asters „Hereditary“ stützt sich insbesondere stark auf die Folk-Horror-Tradition und verwendet Themen wie Familientrauma und heidnische Praktiken, um ein Gefühl von Unbehagen und Angst zu erzeugen. Während seiner Erforschung des Folk-Horrors wirft der Film Fragen nach der kulturellen Bedeutung des Genres und seiner Reflexion unserer kollektiven Ängste und Befürchtungen auf. Folk-Horror wird oft als Reaktion auf die sich verändernde soziale und kulturelle Landschaft der späten 1960er und 1970er Jahre gesehen, einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche und Veränderungen. Die Verwendung ländlicher Umgebungen und heidnischer Praktiken durch das Genre dient als eine starke Metapher für die Entfremdung zwischen der modernen Gesellschaft und der natürlichen Welt. Darüber hinaus beleuchtet der Film den oft übersehenen Einfluss von Folklore und Mythologie auf den Folk-Horror. Die Verwendung mythologischer und folkloristischer Themen durch das Genre dient als Kommentar zu unserer Beziehung zur natürlichen Welt und unserem Platz darin. Filme wie John D. Hancocks Film „Das Mädchen am Ende der Straße“ aus dem Jahr 1976, der ein folkloristisches Thema verwendet, um das Trauma und den Missbrauch eines jungen Mädchens zu erforschen, werden besonders hervorgehoben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Woodlands Dark and Days Bewitched: Eine Geschichte des Folk-Horrors“ eine umfassende Erkundung der reichen und komplexen Geschichte des Genres ist. Von seinen Anfängen in Großbritannien in den späten 1960er Jahren über seine Verbreitung im britischen Fernsehen in den 1970er Jahren bis hin zu seinen zahlreichen Ausprägungen in verschiedenen Ländern hat sich der Folk-Horror im Laufe der Jahre weiterentwickelt und die kulturellen Ängste und Befürchtungen seiner Zeit widergespiegelt. Der Film beleuchtet die Arbeit zahlreicher Filmemacher, die zu dem Genre beigetragen haben, darunter einige der einflussreichsten und kritischsten Erfolge des letzten Jahrzehnts. Durch seine Erforschung des Folk-Horrors wirft der Film Fragen nach der kulturellen Bedeutung des Genres und seiner Reflexion unserer kollektiven Ängste und Befürchtungen auf.
Kritiken
Empfehlungen